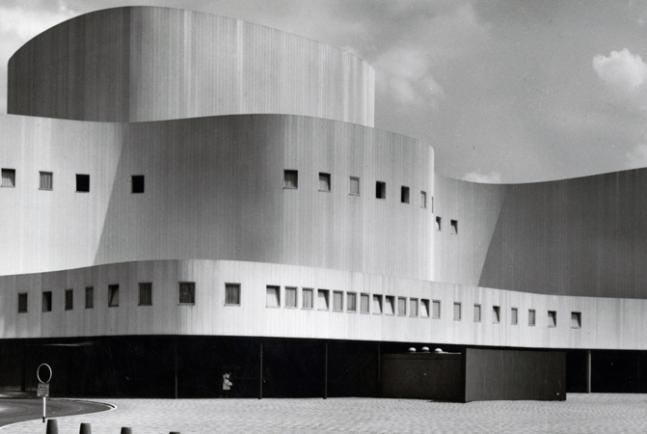Ballade vom Zerfall
Wenn man die Homepage des Regisseurs und Dramatikers Kevin Rittberger aufruft, sieht man sich zunächst einmal einem Buchstabenrätsel gegenüber. Es dauert eine Weile, bis man die Kombinationen „Theater“, „Ton“ und „Musik“ herausgefiltert hat, unter denen man dann nähere Informationen zu seinen Projekten erhält. - Wie ein Buchstabenrätsel mutet zu Beginn auch die Deutsche Erstaufführung von Rittbergers neuestem Stück Puppen am Düsseldorfer Schauspielhaus an mit all seinen absurden Szenen und Satzkonstruktionen. Auch das ist eingebettet in andere rätselhafte Kunstkombinationen: Rittberger hat das Stück in seiner eigenen Regie – anders als Robert Borgmann bei der Uraufführung am Wiener Schauspielhaus – zu einem Triptychon erweitert und sich dazu zweier Düsseldorfer Künstler bedient: Der Komponist Hauschka schrieb eine Ouvertüre zum Stück, der Fotograf und Musiker Stefan Schneider, ehemaliger Meisterschüler von Bernd Becher, schließt einen Diavortrag an. Was entstanden ist, nennen die drei eine „musiktheatralische Installation“.
Ein Stück über die Krise wollte Rittberger schreiben. Er hat fragmentarische Szenen montiert, kurze, zugespitzte Situationen im Leben seiner fünf Figuren, die scheinbar absurde, aber auch poetische und humorvolle Textpassagen beinhalten. Tatsächlich stecken alle Figuren in mehr oder weniger existenziellen persönlichen Krisen, aber der Transfer auf das große Ganze, gar auf die Ebene politischer Systeme, gelingt dem Zuschauer erst spät. Treffend spricht das Programmheft von „einer taumelnden und sich verflüchtigenden Textstruktur“; eine Nähe zu Surrealismus und Dadaismus ist nicht zu übersehen. Die groteske Handlung, die irritierende Wortwahl und Situationenfolge sollen, so Rittberger, „verkrustete Bedeutungen aufsprengen“. Der Zuschauer wird also gefordert – gefordert zum Mitdenken und aufgefordert, eigene Assoziationen zu entwickeln. Wenn ihm das gelingt, erlebt er einen spannenden, hochinteressanten Abend. Und erkennt im Rückblick überraschend logische Abläufe.
Bereits in Hauschkas musikalischer Ouvertüre mit einer sich langsam steigernden Dramatik mag man Menschen erkennen, die kämpfen, die sich in der Krise nicht aufzugeben versuchen; in den ruhigeren Passagen der Musik mag man die passiveren, sich den Bedrohungen der Umwelt ergebende Zeitgenossen sehen. Strukturelemente dieser Musik werden von Stefan Schneider am Synthesizer im Verlaufe des zentralen Schauspiel-Teils der Aufführung wieder aufgenommen und verstärken den traumartigen, bisweilen alptraumartigen Effekt der Szenen. Die werden von merkwürdigen Figuren in krisenartigem Umfeld bestritten wie z. B. dem „Klandestino“ oder dem „Fleischer, der hinter der Auslage steht auch ohne Fleisch“. Tatsächlich spitzt sich das Krisenszenario in den ersten acht der insgesamt neun Szenen zu: Wir erleben eine Entwicklung von eher individuellen Lebenskrisen hin zur Gesellschaftskrise. Am Beginn sehen wir die „Frisörin“, die keine Haare mehr schneiden kann, und den heimatlosen „Klandestino“ mit seinem abenteuerlichen kleinkriminellen Lebenslauf, der sich in sie verliebt. Es scheint um eher individuelle Probleme zu gehen, bis die Friseurin ihn orakelnd fortschickt: „Dieser Ort wird in seine Einzelteile zerfallen.“
Im dritten Kapitel vertritt die „Frau, die vom Schwindel überfallen wird“, den Fleischer, der gar kein Fleisch mehr zu verkaufen hat, aber dennoch ganz normal den Verkaufsprozess fortzusetzen versucht – eine groteske Konstellation, in der sich erstmals gesellschaftspolitische Probleme wie Arbeitslosigkeit, gesellschaftspsychologische Themen wie die Bedeutung der Arbeit für unser Selbst- und Fremdbild abzeichnen und die Frage nach unserer automatisierten Akzeptanz des gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Systems gestellt wird. Den Hunger der Welt könnte der Fleischer stillen, wenn sein Traum von einer 90 Meter langen Wurst wahr würde. In Szene Acht jedoch steht er, arbeitslos, am Pranger, auf einer Art Schafott; vor ihm haben sich als Gaffer oder Ankläger die Musiker aus dem ersten Teil aufgebaut und der „Chor, der die Arbeit abschafft", Abbild unserer bigotten Gesellschaft ruft: „Haben wir nicht alles gemacht, um Ihnen zu helfen?“ – Damit ist der Transfer zur aktuellen Politik endgültig getan. Die Musik, die im Laufe des kurzen Abends von Schneider immer stärker zurückgefahren wurde, wird dissonant und erstirbt schließlich ganz.
Rittberger beschreibt in diesen acht Szenen Zusammenbruch und Zerfall der weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Ordnung und blickt in verfremdender Form auf Krisensymptome und die fehlende gesellschaftliche Solidarität. Doch nach dem endgültigen Zerfall dieser Ordnung gibt es wieder Hoffnung, und es scheint die Möglichkeit einer Liebe und harmonischen Zweisamkeit auf: „Erst wenn alles leer ist, werden wir verstehen“, hatte es zuvor geheißen.
Stefan Schneiders Diavortrag zu seinen „bewegten Fotografien“ bestätigt die Hoffnung auf Beruhigung der aus den Fugen geratenen Welt. Seine Bilder aus kleinbürgerlichen, kleinindustriellen oder landwirtschaftlich geprägten Düsseldorfer Gebieten strahlen nicht die Welt der Reichen und der Schönen aus, aber: Ruhe. Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit, die auch die fünf Figuren des Stückes erfasst zu haben scheinen, die wir in diesen Fotografien wiedertreffen.
Der schwierige Text wird von den fünf Schauspielern mit perfektem Gespür für seinen traurigen Humor und seine absurden Sprachkonstruktionen bewältigt. Fast ohne Requisiten und mit wenig Aktion gelingt es dem herausragenden Ensemble, das Publikum zu fesseln und seine Neugier zu wecken. Insbesondere Karin Pfammatter als „Frau, die vom Schwindel überfallen wird“ überzeugt mit einer virtuosen Balance aus Körperbeherrschung und Sprachakrobatik, mit der sie sich umstandslos ins Choreographische Theater verpflanzen ließe. Alle Akteure in diesen exemplarischen, verfremdeten Szenen sind nur Marionetten in einem von ihnen nicht beherrschten System, aber Pfammatter zeigt dies auch in ihren Bewegungen. „Wenn man Puppen von den Strippen löst - die zappeln noch, bevor sie runterfallen, das muss sich doch irgendwie verwandeln lassen, diese Energie“, sagt sie. Vergeblicher Versuch: Sie stürzt, vom Schwindel überfallen, und wird in den Händen des Klandestino zur Puppe. Rainer Galke steht ihr an Intensität des Spiels kaum nach: Die massige Gestalt des kräftigen Fleischers wirkt mehr und mehr verletzlich; zwischen stoischer Ungläubigkeit und aufwallender Verzweiflung changiert Galkes Spiel, und auch wenn Aufführung und Stück eher auf Brechtsche Distanz angelegt sind, so geht die Szene, in der Galke am Pranger ein ihn vermutlich denunzierendes Schild umgehängt bekommt, emotional nahe.
„Erst wenn alles leer ist, werden wir verstehen“: Ja, der insgesamt recht experimentelle Abend fordert vom Zuschauer die Bereitschaft zur intellektuellen Auseinandersetzung. Offenheit gegenüber einem manchmal hermetisch erscheinenden Konstrukt ist gefragt, mehr noch: Assoziationsfähigkeit. Wer, sobald der Zuschauerraum leer ist, die Abba-CD einlegt oder die Fortuna-Reportage einschaltet, wird nicht verstehen und den Reichtum der Aufführung nicht erkennen. Ein wenig gedankliches Nacharbeiten sei nachdrücklich empfohlen. Vielleicht ist diese exzellente Arbeit des Schauspielhauses ein Minderheiten-Programm. Aber sie ist auch ein heißer Kandidat für „Stücke 2012“ in Mülheim: für die Auswahl der besten sieben oder acht deutschsprachigen Stücke der Saison.