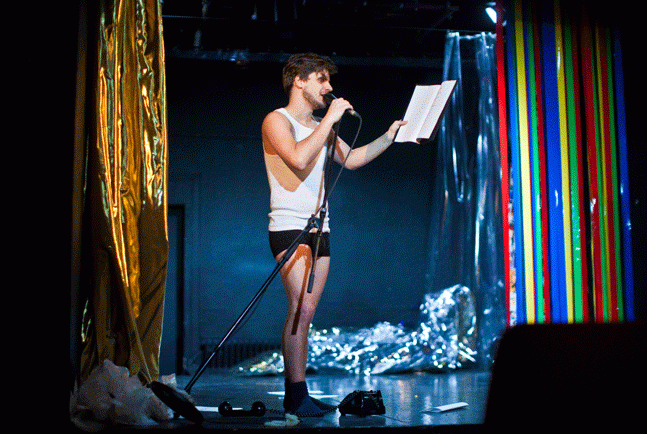Nicht immer Klartext
Mit einem gewissen Nachdruck des Stolzes weist PiaMaria Gehle, Intendantin des noch immer nicht endgültig vor dem Aus geretteten Keller-Theaters, darauf hin, dass man mit Die Ängstlichen und die Brutalen zum ersten Mal ein Stück von Nis-Momme Stockmann in Köln sehen kann. Dabei ist der 31jährige deutsche Autor (mit irgendwelchen dänischen Wurzeln) längst anerkannt, wird viel gespielt und feuilletonistisch gepriesen. Selbst ein als besonders konservativ geltender Großkritiker, der einen selbstverliebt sich gerierenden Modernismus (per Feder, per Inszenierung) schon häufig angegriffen hat, lobt Stockmanns Fähigkeit, „Schrecken und Abgründe der ganzen Welt“ in einer engmaschigen Personenbeziehung aufscheinen zu lassen. Es gibt in der Presse freilich auch Gegenmeinungen, die Stockmann sogar zu einem Mülheimer Manifest veranlassten, in dem er zynische und kalte Scribenten an den Pranger stellt. Gleichzeitig macht er Zuschauern Mut, auch mal „nicht zu begreifen, ratlos zu sein“.
Im „Keller“ nimmt man das in Anspruch, wenn sich der Text mitunter in absonderlichen Nebengedanken verliert. Auch die oft in sich versackende, zersplitterte, keuchende Sprache, von Regisseur Torge Kübler möglicherweise auf die Spitze getrieben, lässt schon mal Konzentration und roten Faden verlieren. Nachdem die beiden famosen Darsteller Robert Oschatz und Jean Paul Baeck, unisono skandierend, erst einmal klar stellen, dass an diesem Abend alles Theaterspiel ist, verwandeln sie sich in Eirik und Berg, Brüder, bei denen es sogleich feindlich knistert. Die beiden treffen in der Wohnung des Vaters aufeinander, den sie dort aber in erbärmlichem Zustand tot auffinden. Der hektisch angstvolle Versuch, diese Situation zu bewältigen (Bestatter anrufen o.ä.?) entbehrt nicht drastischer Komik, wie man sie im Zirkus erleben kann oder von einschlägigen Uralt-Filmen her kennt. Oft schaut auch Becketts Godot um die Ecke.
Frühere Stücke von Stockmann (Der Mann, der die Welt aß, Kein Schiff wird kommen, Das blaue Meer) haben das Vater-Sohn-Verhältnis thematisiert. Jetzt aber ist der Erzeuger tot und lebt nur noch in leicht wirren Aufzeichnungen fort, welche als Lesetexte das Spiel immer wieder zäsieren und das gute alte Verfremdungs-Prinzip à la Brecht wieder aufleben lassen. Aber hinter all dem komödiantischen Gewusele, diesen Worttiraden und hechelnden Rollenspielen zwischen ängstlich und brutal lauert Angst, eine Angst, deren Quelle nicht genannt, nur atmosphärisch angedeutet wird. Man darf sie aber in den Grenzen der Familie vermuten (die Mutter taucht in Eiriks Träumen auf).
Küblers Inszenierung findet für die emotionalen Gratwanderungen wirkungsvolle gestische Momente. Sie fängt auch die Entfremdung der Brüdern ein, welcher Zärtlichkeit aber noch nicht gänzlich abhanden gekommen ist. Robert Oschatz und (noch um Grade variabler) Jean Paul Baeck spielen wie auf des Messers Schneide, virtuos, euphorisch, oft auch gewalttätig. Für das langsame Aufblättern existenzieller Seinsschichten findet die Ausstatterin Christina Mrosek ein treffliches Symbolbild. Nach und nach öffnen sich unterschiedlich gestaltete Zwischenvorhänge, bis das Abgrundschwarz der Brandmauer sichtbar wird.